




juleundjoerg.net
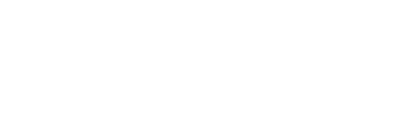

Die Wetteraussichten für den heutigen Sonntag waren ausgezeichnet. Sonnig, angenehme 25 Grad - ideal zum Radfahren. Wir
hatten über Komoot bereits einige Touren für uns ausgearbeitet und entschieden uns Ostwestfalen zu verlassen und die A2 in
Richtung Norden zu fahren.
Nachdem der Fahrradträger am neuen Auto und die Fahrräder darauf gut befestigt waren, ging es gegen 09.30 Uhr los.
Ziel- und Endpunkt unserer Rundtour sollte Hülsede, eine Gemeinde im Südosten des niedersächsischen Landkreises Schaum-
burg sein. Gegen 10.15 Uhr erreichten wir den Parkplatz an der St. Aegidien Kirche.
Die Gemeinde zählt über 1000 Einwohner und gehört zur Samtgemeinde Rodenberg. Hülsede liegt am Nordosthang
des Süntels im Deister-Süntel-Tal. Der Hülseder Bach (ortsüblich Beeke) durchfließt den Ort in einem weitgehend
verrohrten Bachbett und mündet kurz danach in die Rodenberger Aue.

Einen ersten Hinweis auf die Ortschaft
enthalten die um 1150 verfassten Güterverzeichnisse der
Reichsabtei Fulda. Darin ist vermerkt, dass einem Herzog
Bernhard in „Hulside“ zwei Höfe (mansi) zum Lehen
überlassen worden sind. Diese Notiz bezieht sich mit
großer Wahrscheinlichkeit auf die Zeit der Billunger
Herzöge Bernhard I. († 1011) oder Bernhard II. von Sachsen
(† 1059), wobei Historiker den Letzteren vermuten.
Die Tischlergenossenschaft Hülsede war die Keimzelle der
Möbelindustrie im Deister-Süntel-Tal.
Heine-Sitzmöbel in Hülsede ist mit 20 Beschäftigten die
letzte von ehemals über 40 Möbelfabriken in der
Deistergegend.

Los geht´s in Hülsede

Lauenau mit Ortskern, St.-Lukas-Kirche und Schloss

…weiter durch die herrliche Landschaft im Deister-Süntel-Tal

Zurück von Bad Münder nach Hülsede
Schließlich liessen wir die Wiesen und Felder hinter uns uns erreichten Nienstedt und Eimbeckhausen. Da das Deutsche
Stuhlmuseum, welches in Eimbeckhausen beheimatet ist, leider geschlossen hatte, hielten wir uns nicht lange auf und radelten
unserem nächsten Ziel Bad Münder entgegen.

Durch den Wald bis zum Forsthaus Blumenhagen
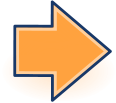

Von Eimbeckhausen nach Bad Münder
Wir erreichten den von unserem Startort Hülsede entferntesten Punkt, die knapp 17.500 Einwohner zählende Kurstadt Bad Münder.
Bad Münder am Deister liegt im Deister-Süntel-Tal an der Bundesstraße 442 und ist umgeben von den bewaldeten Gebirgszügen
Deister und Süntel im Weserbergland, nördlich von Hameln. Die Hamel durchfließt das Stadtgebiet.
Der Ort im Deister-Süntel-Tal wurde zwischen 856 und 869 als „Munimeri“ erstmals erwähnt. Die Heilkraft der Sole-, Schwefel- und
Bitterquellen war schon früh bekannt. Mönche kamen eventuell wegen der Solequellen zu Fuß aus Minden angereist, immerhin fast
50 km. Dadurch könnte der Name „Mindener Sold“ entstanden sein, der sich im Laufe der Zeit zu „Mündener Sold“ entwickelt haben
könnte. Der tatsächliche Ursprung des Namens ist aber ungewiss. Mit Sicherheit taucht Münder im Jahre 1033 in einer Urkunde Kaiser
Konrads II. als „Munnere“ auf. Die seit 1033 bestehende Salzgewinnung wurde erst 1924 eingestellt.
Im Jahre 1936 erhielt Münder den Status einer Kurstadt, so dass Münder zu Bad Münder wurde und heute das Prädikat
„Staatlich anerkannter Heilquellenkurbetrieb“ trägt. Der Kurort besitzt eine reizvolle Altstadt mit historischen
Fachwerkhäusern und Sandsteinbauten aus der Weserrenaissance. Die Stadt lebt heute, außer von der Glas- und
Möbelindustrie, hauptsächlich vom Gesundheitswesen und dem Tourismus.
Die Süntel-Buche, Fagus sylvatica var. ist eine seltene Varietät der Rotbuche (Fagus sylvatica).
Süntel-Buchen beeindrucken durch ihre verdrehten, verkrüppelten, miteinander verwachsenen Äste und ihre sehr kurzen,
drehwüchsigen Stämme. Sie wachsen mehr in die Breite als in die Höhe. Dabei erreichen sie nur selten eine Höhe von über 15 Metern.
Mit ihren herabhängenden Zweigen bilden die Süntelbuchen zeltähnliche, halbkugel- oder pilzförmige Kronen aus. Die Wuchsform ist
erblich, ihre Entstehung aber noch ungeklärt.
Der Name Süntel-Buche stammt von den Vorkommen im Süntel, im Weserbergland in Niedersachsen.
Die Süntelbuche ist je nach Standort unter verschiedenen botanischen Namen, wie Tortuosa, Suntalensis oder Suentelensis und
volkstümlichen Namen, wie Krause Buche, Krüppel-Buche, Schirm-Buche, Schlangen-Buche oder Renk-Buche bekannt. Früher
bezeichnete man sie auch als Hexenholz oder Teufels-Buche, weil man sie als verwunschen oder vom Teufel verdorben ansah.
Nach einer Stärkung beschlossen wir auf die Besichtigung des Kurparks zu verzichten und machten uns auf den Rückweg zu unserem
Ausgangspunkt, nach Hülsede.



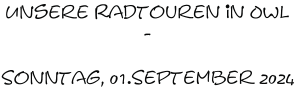
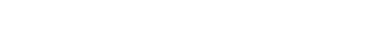


Manch ein aufmerksamer Leser wird sich über die oben verwendeten Bezeichnungen „Flecken“ und „Samtgemeinde“ gewundert
haben...
Der Flecken ist eine Bezeichnung für eine nicht sehr große, aber lokal bedeutende Ansiedlung. Vor allem in Norddeutschland wurde
damit eine Minderstadt bezeichnet; heute gibt es in mehreren deutschen Ländern Orte, die sich offiziell Flecken nennen.
Eine Samtgemeinde (von „gesamt“, „zusammen“) ist in Niedersachsen ein Gemeindeverband, der bestimmte öffentliche Aufgaben
anstelle seiner Mitgliedsgemeinden ausführt. Die Mitgliedsgemeinden bleiben dabei selbständige Körperschaften und führen auch
weiterhin einen eigenen Aufgabenkreis selbstverantwortlich durch.
Der Flecken Lauenau liegt im Deister-Süntel-Tal am westlichen Rand des Höhenzugs Deister, knapp 30 km südwestlich
von Hannover. Die Weser und der Mittellandkanal verlaufen jeweils in etwa 15 km Entfernung. Die Rodenberger Aue
und der Mühlenbach durchfließen den Ort.
Naturräumlich liegt Lauenau im Calenberger Bergland an der Schwelle der deutschen Mittelgebirge zum
Norddeutschen Tiefland. Im weiteren Sinne wird Lauenau auch als Teil des Weserberglands gezählt, obwohl der
gebietsprägende Deister bereits zum Einzugsgebiet der Leine zählt.
In manchen Urkunden kommen die Namen Schwedesdorf und Lauenau nebeneinander vor. Der Name Lauenau stammt aus
späterer Zeit und bezieht sich auf die vom Welfenherzog Heinrich dem Löwen um 1190 errichtete Burg, die später als Gerichtsstätte
diente = Law (Gericht) an der Aue. Durch einen Großbrand wurde Lauenau im Dezember 1682 fast völlig zerstört. Während des
Siebenjährigen Krieges (1756–1763) war der Ort von den Franzosen besetzt.
In jüngerer Vergangenheit war Lauenau ein Schwerpunkt der Stuhl- und Möbelindustrie Niedersachsens. Hier ist besonders die
Schulmöbelfabrik Casala zu nennen. Dank des Erholungs- und Wohnwertes der Umgebung und der günstigen Lage an der
A2 vor den Toren Hannovers gehört Lauenau heute zu den expandierenden Gemeinden der Region.
Das mit dem Namen des Fabrikanten und Unternehmers Carl Sasse (1892–1956) verbundene Unternehmen in Lauenau
wurde mitten im Ersten Weltkrieg im Jahr 1917 gegründet und produzierte anfangs Schuhsohlen aus Holz. Dabei stand
Casala als Abkürzung für Carl Sasse Lauenau. Ende der 1960er Jahre beschäftigten die Casala-Werke rund 1000
Arbeitnehmer.
Nach mehrmaligem Wechsel der Besitzer in den 1980er und 1990er Jahren musste das Lauenauer Stammwerk im Jahr
2001 Insolvenz anmelden.
Der Deister, auch Großer Deister genannt, ist ein maximal 405 m ü. NHN hoher Höhenzug im Calenberger Bergland an der
Nordgrenze des Niedersächsischen Berglandes nahe Hannover in den Landkreisen Schaumburg, Hameln-Pyrmont und der Region
Hannover. Er ist ein beliebtes Naherholungsgebiet.
Der Deister liegt rund 20 km südwestlich von Hannover. Er erstreckt sich zwischen den Ortschaften Bad Nenndorf im Nordwesten,
Barsinghausen im Norden, Wennigsen im Nordosten, Bennigsen im Osten, Springe im Südosten, Bad Münder im Süden,
Eimbeckhausen im Südwesten und Lauenau sowie Rodenberg im Westen auf etwa 21 km Länge; seine Breite liegt im Mittel bei vier
Kilometern. In südöstlicher Verlängerung schließt sich der Höhenzug des Kleinen Deisters an.
Der Bergzug ist von einem Buchen-Fichten-, teilweise auch Buchen-Eichen-Forst bzw. -Mischwald bedeckt. An der Cecilienhöhe bei
Bad Nenndorf, am Grillplatz Lauenau-Feggendorf und südwestlich vom ehemaligen Forsthaus Köllnischfeld stehen noch mehrere
Exemplare der seltenen, hier heimischen Süntelbuchen.
Zu den seltenen Pflanzen des Deisters gehören unter anderem auch Hülse (Stechpalme), Seidelbast, Knabenkräuter, Gelappter
Schildfarn und Großes Schneeglöckchen.
Der Deister beherbergt eine für deutsche Mittelgebirge typische Tierwelt. Rot-, Reh- und Schwarzwild kommen zahlreich vor.
Weitere vorkommende Haarwildarten sind Baum- und Steinmarder, Hermelin, Iltis und Mauswiesel sowie der Fuchs. Mittlerweile ist
er auch Heimat von Bioinvasoren wie Waschbär und Marderhund. Beheimatet sind die Greifvogelarten Mäusebussard, Habicht und
Rotmilan. Von den selteneren Kleintieren sind hier die Fledermausarten Mausohr und Kleine Hufeisennase zu Hause.
Das Forsthaus Blumenhagen mit seinem Biergarten mitten im Wald sah sehr einladend aus und die Bewertungen im Internet lassen
darauf schließen, dass man hier sehr gut Einkehren und Speisen kann.
Für uns war es noch ein wenig zu früh und wir hatten noch den Großteil der Strecke vor uns. Also kurz orientiert und dann weiter in
Richtung Nienstedt und Eimbeckhausen. Die Strecke war nun doch etwas beschwerlicher und aufgrund der, mit dem E-Bike relativ
schlecht zu befahrenden Passagen aus Feld- und Wiesenwegen, eher etwas für Mountainbiker. Aber wir hielten durch und wurden mit
tollen Ausblicken belohnt.
Die Landschaft im Deister-Süntel-Tal ist beeindruckend. Die ausgearbeitete Radstrecke war, bis auf ein paar Streckenabschnitte
zwischen Blumenhagen und Nienstedt sehr gut befahrbar. Bis auf ein paar Wanderer, denn dies Gebiet eignet sich auch hervorragend
für Wanderungen, war hier nicht viel los. Meidet man
die Bundesstraße 442 (an der aber auch ein separater
Radweg entlang führt), so hat man auch nicht viel
Autoverkehr (zumindest am Wochenende).
Bad Münder ist ein tolles Ziel, welches einen längeren
Aufenthalt lohnt. Den Kurpark und/oder weitere
Sehenswürdgkeiten in der näheren Umgebung haben
wir ausgelassen.
Für interessierte ist bestimmt auch das Deutsche
Stuhlmuseum in Eimbeckhausen ein Besuch wert.
Uns hat die Natur auf dieser Tour begeistert und
nach knapp 39 Kilometern beendeten wir die Tour in
einer Landschaft, an der viele nur auf Ihrem Weg von
Bielefeld/Minden nach Hannover über die Autobahn 2
vorbeifahren.

Fazit:

Die ev.-luth. Pfarrkirche St. Ägidien wurde in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts auf den Resten einer Vorgängerkirche als
Bruchsteinbau erbaut. Die Deckenmalereien des Mindener Meisters Jürgen Dove aus dem Jahr 1577 wurden 2013 umfassend
restauriert. Unter Denkmalschutz stehen neben der Kirche auch das Pfarrhaus von 1810 und eine ehemalige Scheune.
Zum Wasserschloss Hülsede, einem im Stil der Weserrenaissance in Hülsede erbauten Schloss, kommen wir am Ende unserer Tour.
Erster Stop auf unserer Tour war der ca. 4.500 Einwohner zählende Flecken Lauenau.

Deisterland = Greifvogelland - hier Rotmilane


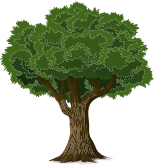






Durch Wald und Flur


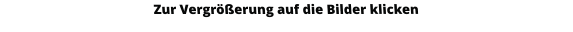
Bad Münder am Deister


Der Rückweg ging fix und über den Ort mit dem für uns komischen Namen Schmarrie erreichten wir Hülsede. Bevor wir die Rück- fahrt
antraten, machten wir noch einen Fotostop beim Wasserschloss Hülsede.
Das Wasserschloss besteht aus einer 35 × 32 m großen Dreiflügelanlage um einen rechteckigen Innenhof, die von einer 10–15 m
breiten Gräfte umgeben ist. Die Nordwestseite wird durch ein schmales Torgebäude abgeschlossen. Eine Mauer umfasst die
Hauptburg und die westlich angrenzenden Wirtschaftsgebäude der Vorburg. Ursprünglich war das Schloss von einem hohen Wall mit
Eckrondellen und einem zweiten Außengraben befestigt. Das laut Inschrift 1529 errichtete „Alte Wohnhaus“ bildet zusammen mit
einem Verbindungsbau den Nordostflügel des Schlosses.
Über die Baugeschichte der mittelalterlichen Anlage existieren keinerlei Aufschlüsse. Der Bau des Schlosses erfolgte in mehreren,
aufeinander folgenden Schritten. Zunächst wurde von 1517 bis 1529 das „Alte Wohnhaus“ im Nordosten errichtet.

